Amphibole
(Hornblenden)
(Na,K)0–1(Ca,Na)2(Mg,Fe2+,Fe3+,Al)5[(OH,F)2/(Si,Al)2Si6O22]
Amphibole bilden eine
komplexe Mineralgruppe, deren einzelne Mitglieder für einen Amateur nicht zu
bestimmen sind. Im Gelände genügt es völlig, Amphibole überhaupt zu
erkennen.
Manchmal wird der Begriff „Hornblende“ benutzt, wenn es um Amphibole geht.
Hornblende ist ein Amphibol mit definierter Zusammensetzung und die
Amphibole in vielen Gesteinen sind in der Tat Hornblenden. Trotzdem gilt:
Hornblende ist nur einer unter vielen Amphibolen und nicht jeder Amphibol
ist eine Hornblende. Da wir die genaue Zusammensetzung der Minerale nicht
kennen, ist es sinnvoll, von „Amphibol“ zu reden.
Amphibole erkennen
Alle Amphibole haben
zwei sehr gute Spaltbarkeiten und eine Härte von etwa 6. Die sehr gute
Spaltbarkeit zeigt sich an den glatten, spiegelnden Spaltflächen,
deren Glanz mit dem frischer Feldspäte vergleichbar ist. Ebenso wie
Feldspäte bilden auch Amphibole in sich gestufte Spaltflächen und ebenso wie
ein Feldspat spiegeln Amphibole im Ganzen, wenn sie ins Licht gedreht
werden. Das intensive Glitzern der Amphibole fällt jedem auf, der das
Mineral in der Hand hält.

(Spiegelung als Animation)
Amphibole kommen oft zusammen mit Biotit vor, der einen ähnlich starken Glanz hat. Vergleicht man beide, zeigen sich zwei Unterschiede. Erstens sind Amphibole meist tiefschwarz, während die Biotitschuppen am Rand etwas durchscheinend sind und manchmal auch einen Braunton aufweisen. Zweitens sind die Spaltflächen der Glimmer oft etwas verbogen und wellig, während Amphibole glatte Spaltflächen haben.
Amphibole gibt es in
magmatischen Gesteinen ebenso wie in metamorphen, vor allem in solchen mit
höheren Metamorphosegraden (Amphibolitfazies). In magmatischen Gesteinen ist
der Amphibol fast immer tiefschwarz, in metamorphen Gesteinen kommen
schwarzgrüne und grüne Farben hinzu.
Die Amphibole in magmatischen Gesteinen sehen meist gedrungen aus, während
man in metamorphen Gesteinen auch schlanke oder nadelförmige Amphibole
findet. Diese Kristalle stecken oft in einer feinkörnigen Matrix und sind
dort erst während der Metamorphose gewachsen. Sie sind dann keine
Einsprenglinge, sondern Porphyroblasten.
Im Glazialgeschiebe aus Skandinavien kommen regelmäßig Amphibolite
vor. Sie bestehen überwiegend aus schwarzem Amphibol und stellen metamorph
umgewandelte, ehemalige Gabbros bzw. mafische Ganggesteine dar. In
Amphiboliten bilden die Amphibole zusammen mit Plagioklas (und mehr oder
weniger Granat) ein meist gleichkörniges Gefüge. Schlanke Kristalle gibt es
in Amphiboliten nicht. Auch diese Amphibole zeichnen sich durch lebhaften
Glanz auf den Spaltflächen aus. Bewegt man so einen Amphibolit in der Sonne,
glitzern alle dunklen Minerale auffällig.

Alles Schwarze in beiden Bildern ist Amphibol, die braunrötlichen Körner
sind Granate. (Animation)

Amphibole werden
gelegentlich von anderen Mineralen durchwachsen. Unter der Lupe zeigen sich
in den Spaltflächen des Amphibols kleine Einschlüsse, die Kristalle wirken
„schmutzig“. (Spiegelung
als Animation)

Im Ausschnitt unten kann man winzige braune und hellgraue Einschlüsse
erkennen, die aber wegen der winzigen Abmessungen nicht näher bestimmbar
sind.

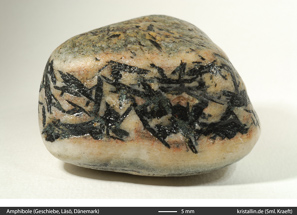 Metamorph
gewachsene Amphibole bilden gern schlanke Kristalle in einer feinkörnigen
Grundmasse. Diese Gesteine können hell oder dunkel sein, die Amphibole sind
meist schwarz. Das erste Beispiel für so ein Gestein ist ein Geschiebe.
Metamorph
gewachsene Amphibole bilden gern schlanke Kristalle in einer feinkörnigen
Grundmasse. Diese Gesteine können hell oder dunkel sein, die Amphibole sind
meist schwarz. Das erste Beispiel für so ein Gestein ist ein Geschiebe.
Das folgende Stück stammt
als loser Stein aus der Nähe von Porsgrunn in Norwegen. Es enthält
massenhaft schlanke Amphibolnadeln.


Ähnliche Gesteine gibt es
auch in Schweden. Bei Skyshyttan in Bergslagen stehen gedritführende
Metamorphite an (unten). Gedrit ist ein Amphibol.


Ein in metamorphen Gesteinen häufiger Amphibol ist Aktinolith (Strahlstein),
dessen Kristalle dunkelgrün aussehen.


Sind solche schlanken
Kristalle sehr klein, kann man sie makroskopisch nicht bestimmen, da die
Spaltwinkel nicht mehr zu erkennen sind. (Zu Spaltwinkeln siehe nächster
Abschnitt.) Zwar sind die meisten schwarzen und schlanken Kristalle
Amphibole, aber man muss sich hüten, alle dunklen und schlanken Minerale
pauschal als Amphibole anzusprechen. In Alkaligesteinen kann Ägirin
vorkommen, der schlank und schwarz wie ein Amphibol aussieht, jedoch zu den
Pyroxenen gehört.

Diese Gesteine kommen in
Skandinavien im Oslograben und in Alkaliintrusionen Schwedens vor. Ein
bekanntes Beispiel ist der Särna-Tinguait (oben).
Dessen schwarze Nadeln sind keine Amphibole, sondern Ägirin, ein
Na-Pyroxen.
Wenn man sich merkt, dass die schwarzen Nadeln in einem grünen Porphyr
Ägirin sein können, ist dieser Fallstrick - die Verwechselung mit einem
Amphibol - vermeidbar. Ägirin kommt aber auch in weniger auffälligen
Gesteinen vor, so dass man bei schwarzen, schlanken Kristallen generell
vorsichtig sein muss. Das gilt vor allem in Gebieten mit Alkaligesteinen wie
dem Oslograben in Norwegen.
Auch schwarzer Turmalin (Schörl) bildet Kristalle, die Amphibolen ähneln
(unten). Sie unterscheiden sich jedoch durch fehlende Spaltbarkeit, haben
also einen rauen Bruch und dazu den turmalintypischen
dreieckigen Querschnitt. Außerdem ist Turmalin ähnlich hart wie Quarz,
also nicht ritzbar.
In makroskopisch relevanter Größe kommen Turmaline hauptsächlich in
Granitpegmatiten oder in Graniten vor, also durchweg sehr hellen Gesteinen.

Turmaline sind noch seltener als die grünen Tinguaite. Eine Verwechselung
kann vermieden werden, wenn man auf die fehlende Spaltbarkeit achtet.
Die Spaltwinkel der Amphibole
Neben Spaltbarkeit und
Härte gibt es ein weiteres Merkmal, das alle Amphibole auszeichnet: Ein
Winkel von etwa 60° bzw. 120° zwischen den Spaltflächen.
Das schwarze Mineral hier ist ein Amphibol-Spaltstück, also der Rest
eines ehemals größeren Kristalls. Alle seine spiegelnden Flächen sind
Spaltflächen. Diese Spaltflächen haben gemeinsame Kanten, die in eine
Richtung weisen. In diesem Fall steil von links unten nach rechts oben. Um
die Spaltwinkel zu sehen, muss man entlang dieser Kanten schauen (Pfeil).
Dann ergibt sich eine Ansicht, die als Kopfschnitt bezeichnet wird.

Der Kopfschnitt (unten) ist der Blick entlang der Hauptachse des Kristalls.
Diese Längsachse ist mit den langen Kanten identisch, die von den
Spaltflächen gebildet werden.

Nur aus dieser Perspektive sieht man die Winkel von 60 ° bzw. 120°.
Wer die Spaltwinkel sucht, muss daher zuerst die Kanten finden, die von den Spaltflächen gebildet werden. Dann dreht man das Handstück so, dass man flach entlang dieser Kanten peilen kann und wenn die Kristalle nicht zu klein sind, zeigen sich die Winkel zwischen den Spaltflächen. Dafür muss der Amphibol eine gewisse Mindestgröße haben. Bei sehr kleinen Kristallen versagt diese Methode. So deutliche und große Spaltwinkel wie hier im Bild sind die absolute Ausnahme. Es hat lange gedauert, so ein schönes Stück zum Fotografieren zu finden.
Es kann am Anfang etwas
mühsam sein, die Kanten zwischen den Spaltflächen zu finden. Deshalb noch
zwei Bilder dazu. In beiden zeigen die weißen Pfeile auf die Kanten, die von
den Spaltflächen gebildet werden. Diese Kanten suchen Sie und entlang derer
peilen Sie, um die Winkel zu suchen. Das Handstück muss dafür jeweils
gekippt werden. Aus dem Blickwinkel, aus dem die Fotos hier gemacht wurden,
kann man die Winkel zwischen den Spaltflächen nicht gut erkennen.

Vergrößerung ohne Beschriftung
Beim Peilen muss man
aufpassen, die richtigen Kanten zu erwischen. Die im oberen Bild quer
verlaufenden sind Bruchkanten und die dürfen Sie nicht benutzen (rote
Pfeile). Das erkennen Sie daran, dass eine der beiden Flächen, die diese
Bruchkanten bilden, eine raue (!) Bruchfläche ist. Man muss deshalb immer
mit den glatten Spaltflächen anfangen und dann die Kanten suchen.

Asbest
Amphibole kommen auch in
langfaseriger Form vor, die als Asbest bezeichnet werden. Der Begriff deckt
verschiedene Amphibole ab, auf deren Zusammensetzung hier nicht weiter
eingegangen werden soll.
Asbest war lange Zeit ein geschätztes Mineral, da die dünnen Amphibolfasern
gesponnen und zu unbrennbaren Textilien verarbeitet werden konnten. Auch
feste Werkstoffe wurden durch Asbest belastbarer, da die Fasern wie eine
Armierung wirken. Inzwischen ist aus dem berühmten Mineral ein eher
berüchtigtes geworden, da Asbest Krebs auslösen kann. Das tut aber der
Faszination, dass die Natur mineralische Fasern hervorbringt, keinen
Abbruch.

Das Asbeststück hier ist, mineralogisch gesprochen, sauber. Alle Fasern sind
Teil des Gesteins.

Zusammenfassung:
Amphibole fallen vor allem durch den lebhaften Glanz ihrer Spaltflächen auf.
Diese sind oft in sich gestuft und bilden kleine Treppchen, ähnlich wie die
Feldspäte. Die allermeisten Amphibole sind schwarz oder dunkelgrün und so
hart, dass man sie nicht oder nur mit Mühe ritzen kann.
Zwischen den Spaltflächen bilden Amphibole charakteristische Winkel von etwa
60° und 120°. Diese Winkel sieht man bei ausreichend großen Kristallen, wenn
man in Längsrichtung der Kanten peilt, die von benachbarten Spaltflächen
gebildet werden. Sind die Amphibole klein, kann es mühsam oder sogar
vergeblich sein, die Spaltwinkel zu suchen. Deshalb spielen sie bei der
Bestimmung mit der Lupe keine primäre Rolle. Im Vordergrund steht die gute
Spaltbarkeit, die sich in kräftig spiegelnden, schwarzen Spaltflächen zeigt.
Findet man die, muss nur geklärt werden, ob das Mineral weich ist (dann ist
es Biotit) oder hart (Amphibol). Mit etwas Übung erkennt man das bereits
daran, wie die Spaltflächen reflektieren.
Immer wieder findet man in
Gesteinen dunkle Minerale ohne erkennbare Spaltflächen. Sind solche
stumpfschwarzen Minerale ritzbar, sollte man genau prüfen, ob es sich nicht
doch um Glimmer handelt. Findet man keine Glimmerschuppen, muss man von
zersetzten dunklen Mineralen ausgehen, die für Amateure nicht bestimmbar
sind. An dieser Stelle kommt man dann nicht weiter.
Wer gezielt Amphibole sucht, sollte im Glazialgeschiebe auf schwarze,
glitzernde Steine achten. Weiterhin stecken Amphibole in manchen Gneisen, in
vielen schwarz-weißen magmatischen Gesteinen, die Quarz enthalten (Granodiorite)
und auch in Rapakiwi-Graniten.
Druckfassung (pdf)
Bilder benutzen
