Feldspäte (Zum Beispiel Orthoklas KAlSi3O8)
Feldspäte sind die
häufigsten gesteinsbildenden Minerale. Viele Gesteine bestehen überwiegend
aus Feldspäten (und Quarz) und genau deshalb hat man diese Minerale in den
Mittelpunkt der Gesteinsbestimmung gerückt.


Steinstrand und anstehender Granit - all das besteht
überwiegend aus Feldspäten.
Feldspäte bestimmen
Es gibt zwei verschiedene
Feldspäte: Alkalifeldspat und Plagioklas.
Beide haben eine Härte von etwa 6, sind also kaum oder nur mit Anstrengung
zu ritzen. Ihre namensgebende Eigenschaft ist die Spaltbarkeit: Zerbricht
man einen Feldspat, entstehen spiegelnde, ebene Spaltflächen, die einen
rechten Winkel bilden (beim Alkalifeldspat) bzw. einen beinahe rechten
Winkel beim Plagioklas. Wie das praktisch aussieht, zeigt das folgende Bild eines
Spaltstücks. So ein Spaltstück
entsteht, wenn ein Feldspat zerbrochen wird.


Im linken Bild zeigen die
glatten Spaltflächen nach links und nach oben. Die unebene Bruchfläche liegt
vorn. Das Bild daneben zeigt den Blick genau auf die Bruchfläche, wobei der
rechte Winkel zwischen den Spaltflächen schön erkennbar ist. Feldspäte haben
zwei Spaltbarkeiten, deshalb gibt es Spaltflächen in zwei Richtungen.
Die dritte ist immer rau. Erst bei drei Spaltbarkeiten würden alle Flächen
auch Spaltflächen sein. Die Anzahl der Spaltbarkeiten ist typisch für die
einzelnen Minerale.
Während das Bild oben ein Spaltstück zeigt, ist im nächsten Bild ein vollständiger Feldspatkristall zu sehen. Solche
unbeschädigt freigelegten Kristalle sieht man selten, da die Feldspäte beim Zerteilen der Gesteine meist
zerbrechen.

Vergrößerung ohne Beschriftung
In der Regel sehen wir die Feldspäte nur im Querschnitt, wobei die Form von der
zufälligen Richtung abhängt, in der sie im Gestein liegen.
Eigengestaltige („idiomorphe“) Kristalle erkennt man dann nur an ihren
geraden Außenkanten und den symmetrischen Umrissen. Im Bild oberhalb sind
die hell fleischfarbenen und die kleinen dunkelbraunen Feldspäte idiomorph
(Pfeile). Von beiden gibt es Kristalle mit geraden Außenkanten und auch
solche, die unregelmäßig aussehen. Die fleischfarbenen Kristalle sind
Alkalifeldspäte, die dunklen Plagioklase. Das graue ist Quarz. In vielen
Gesteinen überwiegt Alkalifeldspat, vor allem in bunten Graniten.
Schwarz-weiße Gesteine dagegen enthalten mehr Plagioklas, oft ist er sogar
einziger Feldspat.
Die Zusammensetzung der Feldspäte
Alle Feldspäte bestehen aus Aluminium, Silizium und Sauerstoff. Dazu kommen noch die Metalle Kalium, Natrium und Kalzium, die für die unterschiedlichen Eigenschaften der Feldspäte sorgen. Dargestellt wird die Zusammensetzung der Feldspäte in einem Dreieck.
An der linken Seite stehen
die Alkalifeldspäte. Oben (hier blau) der reine Kalifeldspat, unten links
der Natriumfeldspat Albit. Beide zusammen bilden die Alkalifeldspäte.
Die Plagioklase liegen unten an der Basis des Dreiecks. Plagioklase sind
Mischkristalle aus Natriumfeldspat (Albit) und Kalziumfeldspat (Anorthit).
Albit gehört also zu den Alkalifeldspäten und zu den Plagioklasen.
Es gibt in der Natur nur Feldspäte mit einer Zusammensetzung innerhalb der
farbigen Felder. Feldspäte, deren Zusammensetzung innerhalb der
schraffierten Zone liegen würde, kommen nicht vor, da solche Mischungen
keine stabilen Kristalle bilden können. Die schraffierte Fläche ist die
Mischungslücke der Feldspäte. Wie groß diese Lücke ist, hängt von der
Temperatur ab.
Im ersten Diagramm (oben) ist die Mischungslücke für Normaltemperatur skizziert, das zweite hier unterhalb zeigt die Verhältnisse bei hoher Temperatur.
Die Mischungslücke
betrifft vor allem die Alkalifeldspäte an der linken Flanke. Bei hoher
Temperatur sind alle Mischungen möglich, während bei niedriger Temperatur
die Mischbarkeit stark abnimmt.
Das bedeutet: Ein Feldspat, der zur Hälfte aus beiden Anteilen bestehen
würde (gelber Pfeil), kann nur bei hohen Temperaturen einen einzigen,
homogenen Kristall bilden.
Bei sinkender Temperatur gerät er in die Mischungslücke und zerfällt in zwei Komponenten (Pfeile).
Bei dieser Entmischung
bleibt der Feldspatkristall erhalten, aber die Trennung von Kalifeldspat und
Albit wird sichtbar. Die Natriumkomponente (Albit) scheidet sich in
Form heller Streifen im Kalifeldspat ab. Diese Streifen nennt man
perthitische Entmischungen.


Die hellen Streifen in diesem braunen Feldspat sind die perthitischen
Entmischungen. Sie sind ein sicheres Erkennungsmerkmal für
Alkalifeldspäte. Diese Entmischungen erscheinen als helle Streifen bzw.
schlanke Spindeln, die nicht sehr lang sind. Sie sind immer leicht
unregelmäßig und manchmal auch etwas knotig.
Man findet diese
Entmischungen nur in Gesteinen, die ausreichend langsam abkühlen konnten,
denn sie brauchen viel Zeit zu ihrer Bildung. Dazu noch weitere Beispiele:


Links: Der Alkalifeldspatkristall in der Mitte hat die perthitischen
Entmischungen nur in den gelbfleckigen Teilen. Das umgebende hellrötliche
Mineral ist zwar ebenfalls Alkalifeldspat, hier aber ohne perthitische
Entmischungen. Rechts: Die Entmischungen sehen etwas knotig aus. Im unteren
Teil des Kristalls zeichnet der entmischte Albit die äußere Kontur des
Kristalls nach.
Unten links: Die beiden
braun-fleckigen Kristalle im Bild sind die Alkalifeldspäte. Sie stecken
voller perthitischer Entmischungen, die zum Teil sehr klein sind (Pfeile).
Das kräftig blaue Mineral ist Quarz.
Im Bild rechts ist ein Alkalifeldspat zu sehen, in dem die perthitischen
Entmischungen die Umrisse früherer Wachstumsperioden nachzeichnen. Das ist
aber keine echte Zonierung, bei der sich die chemische Zusammensetzung des
Minerals von innen nach außen langsam geändert hat, denn die gibt es nur bei
Plagioklasen. Hier hat sich der entmischte Albit so abgeschieden, dass er
das Kristallwachstum nachzeichnet.


Unten: Die weißen,
senkrecht verlaufenden Linien sind die perthitischen Entmischungen. Das
Rötliche sind Risse im
Feldspat.

Wenn Sie Ihre ersten
Entmischungen suchen, empfehlen sich grobkörnige und bunte Gesteine.
Konzentrieren Sie sich auf die großen, kräftig gefärbten Einsprenglinge,
denn das sind die Alkalifeldspäte. Je größer die Feldspäte, desto leichter
finden Sie die Entmischungslamellen. Allerdings ist nicht jeder
Alkalifeldspat entmischt, denn die Bildung der perthitischen Entmischungen
hängt von der Zusammensetzung und der Abkühlungsgeschichte des Gesteins ab.
Zwillingsbildungen bei Feldspäten
Alle Feldspäte bilden
Zwillinge.
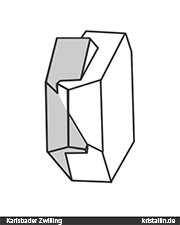 Damit
ist gemeint, dass sich zwei oder mehr Kristalle zu einem größeren verbinden.
Diese Zwillinge sehen je nach Feldspat verschieden aus und sind eine
wichtige Hilfe bei der Bestimmung der Gesteine.
Damit
ist gemeint, dass sich zwei oder mehr Kristalle zu einem größeren verbinden.
Diese Zwillinge sehen je nach Feldspat verschieden aus und sind eine
wichtige Hilfe bei der Bestimmung der Gesteine.
Karlsbader Zwillinge beim Alkalifeldspat
Dieser Zwilling besteht aus zwei Kristallen, die wie zwei Hände miteinander
verschränkt sind und wird „Karlsbader Zwilling“ genannt. Die
Erstbeschreibung wurde an Feldspäten aus der Gegend um Karlsbad gemacht,
daher der Name. Die Skizze zeigt das Prinzip.
Die Fotos zeigen ein sehr großes Exemplar aus Karlsbad.


So ein von der
Verwitterung freigelegter, isolierter Zwilling ist selten und soll hier nur
helfen, das Aussehen dieser Doppelkristalle zu verstehen. In Gesteinen
erkennt man sie daran, dass nur ein Teil des Feldspatkristalls
spiegelt. Da jeder Zwilling ein eigenes Kristallgitter hat, reflektiert
immer nur eine der beiden Hälften. Im linken Bild ist das die linke
Teilfläche. Rechts ist der komplette Kristall markiert.


Die rechte Teilfläche spiegelt erst dann, wenn das Licht aus ganz anderer
Richtung einfällt. Solche teilweise spiegelnden Feldspäte suchen Sie bei der
Gesteinsbestimmung.

(Reflexe
als Animation zeigen.)
Das obere Bild zeigt einen
porphyrischen Granit mit mehreren Karlsbader Zwillingen. Unten spiegelt ein
einzelner gerundeter Feldspat, der aus einem Karlsbader Zwilling besteht.
Für beide Bilder gibt es eine Animation.
(Ovoid
als
Animation zeigen)

So ein Karlsbader Zwilling
muss weder genau in der Mitte noch exakt in Längsrichtung geteilt sein. Die
Naht zwischen beiden Hälften kann geknickt sein oder schräg verlaufen.
Manchmal spiegelt nur ein kleines oder besonders großes Stück, immer aber
gibt es einen nicht reflektierenden Anteil am Kristall.

Hier ist die obere, nicht
spiegelnde Hälfte kleiner als der reflektierende Teil. Der ganze Feldspat
reicht bis zum hellblauen Quarz oben.
Wie groß die jeweiligen Hälften erscheinen, hängt allein von der Richtung
ab, in der der Zwilling zerteilt wurde und die ist völlig zufällig.
Für die Bestimmung als Alkalifeldspat genügt es, wenn Sie Karlsbader Zwillinge oder perthitische Entmischungen oder beides bei einigen Feldspäten finden. Sie können dann davon ausgehen, dass in diesem Gestein auch alle anderen Feldspäte mit gleicher Farbe Alkalifeldspäte sind. Das Fehlen von perthitischen Entmischungen oder Karlsbader Zwillingen erlaubt jedoch nicht den Umkehrschluss, dass dieses Mineral kein Alkalifeldspat sei. Viele Alkalifeldspäte haben weder erkennbare Zwillinge noch perthitische Entmischungen.
Orthoklas und Mikroklin
In Gesteinsbeschreibungen
findet man die Begriffe „Orthoklas“ und „Mikroklin“. Beide beziehen sich auf
das Kristallgitter der Kalifeldspäte, das je nach Abkühlungsgeschwindigkeit
unterschiedlich symmetrisch ist. Ob ein Kalifeldspat als Orthoklas oder als
Mikroklin vorliegt, ist nur mit einem Mikroskop zu klären und für die
Bestimmung von Hand ohne Belang. Die meisten Kalifeldspäte sind Orthoklase.
Mikroklin benötigt eine besonders langsame Abkühlung und viele Mikrokline
zeigen starke perthitische Entmischungen, die ja ebenfalls nur bei langsamer
Abkühlung entstehen.
Sanidin
Sanidin ist ein
Alkalifeldspat, der besonders schnell abkühlte und deshalb keine
perthitische Entmischung bilden konnte. Er ist neben Orthoklas und Mikroklin
die dritte
kristallographische Variante von Kalifeldspat und kommt ausschließlich in
Vulkaniten vor. Typische Gesteine sind Rhyolithe, Trachyte oder Phonolithe.
Sanidin ist im Idealfall glasklar und idiomorph. Das Bild zeigt solche
völlig klaren Sanidinkristalle in einem Phonolith aus der Eifel.

Unten: Zwei Vulkanite mit
jeweils hellen Sanidinen als Einsprenglinge. In beiden Gesteinen sind die
Sanidine rissig und deshalb trüb.
Unten: Auch der Sanidin im
Trachyt vom Drachenfels ist stark rissig.
Wegen der vielen
parallelen Risse könnte man hier auch perthitische Entmischungen vermuten.
Das trifft aber nicht zu, denn der Feldspat ist zwischen den Rissen klar.
Dazu muss man genau hinsehen. Außerdem ist das einbettende Gestein ein
feinkörniger Vulkanit, in dem es grundsätzlich keine perthitischen
Entmischungen gibt. Die findet man nur in den deutlich körnigeren
Tiefengesteinen, weil nur diese sich ausreichend langsam abkühlen.

Für die Bestimmung der
Gesteine ist die Unterscheidung von Sanidin und Orthoklas nur eine
Ergänzung, denn beide sind Alkalifeldspäte.
Zwillinge bei Plagioklas

Plagioklaszwillinge
bestehen aus einer Vielzahl hauchdünner Scheiben, die dicht an dicht liegen
und gemeinsam einen Kristall bilden. Diese Verwachsung nennt man
polysynthetische Verzwillingung. Sie sind nur mit einer Lupe zu erkennen
und erscheinen als feine, streng parallele Linien, die wie mit dem
Lineal gezogen sind.

Diese dünnen,
schnurgeraden Linien sind ein sicheres Kennzeichen für Plagioklas. Sie sind
nur auf den spiegelnden Spaltflächen zu sehen. Deshalb müssen Sie
zuerst die Feldspäte in Reflexionsstellung bringen und dann mit der Lupe in
der glänzenden Fläche nach den feinen Linien suchen.


Im Gegensatz zu den
bisherigen Kennzeichen der Alkalifeldspäte treten die polysynthetischen
Verzwillingungen der Plagioklase verlässlich auf, sofern das Gestein nicht
stark zersetzt ist. Die Zwillingsstreifen sind meistens sehr klein, Sie
müssen deshalb genau hinschauen.
Viele Plagioklase bilden schlanke Tafeln im Gestein. Diese zeigen die
Zwillingsstreifen nur auf der schmalen Seite.
Die polysynthetischen
Verzwillingungen zu erkennen, erfordert vom Anfänger Geduld und viel Übung.
Die Streifen können so winzig wie ein Haar sein. Wenn Sie Plagioklase
vermuten, aber nicht voran kommen, nehmen Sie den Stein anders in die Hand
und achten Sie auf ausreichendes Licht. Am besten benutzen Sie eine kräftige
Lampe oder direktes Sonnenlicht.
Verzwillingungen, die perfekt vom linken bis zum rechten Rand des Feldspats
reichen, sind nicht die Regel. Oft sind die Streifen nur in einem Teil des
Kristalls zu erkennen, was für die Bestimmung aber völlig ausreicht. In den
folgenden Beispielen sind die Plagioklaszwillinge eindeutig zu sehen, wenn
auch nur in einem Teil der Feldspäte.


Der folgende Plagioklas
ist noch kleiner:


Es geht um den schlanken Kristall, der oberhalb der Mitte fast senkrecht
steht. Der Plagioklas ist etwa 1 mm breit und zeigt nur in der linken Hälfte
die Zwillingsstreifen. Das ist nicht viel, aber völlig ausreichend.
Vergrößern Sie das Bild, um Einzelheiten zu erkennen, rechts ist der ganze
Kristall markiert. Auch allen anderen weißen Minerale hier sind Plagioklase.
Um ihre Spaltflächen zu sehen, muss man den Stein bewegen.
Spätestens hier wird klar, warum man mit einer normalen Leselupe scheitert. Ohne die polysynthetischen Zwillingsstreifen können Sie keine Plagioklase erkennen und ohne Plagioklase gibt es keine Gesteinsbestimmung.
An dieser Stelle ein Blick
zurück zu den Alkalifeldspäten. Bei deren halbseitig spiegelnden Karlsbader
Zwillingen lauert nämlich eine Falle. Manchmal sind bei den Plagioklasen die
Zwillingsstreifen zu größeren Gruppen verbunden. Dann spiegelt der Kristall
zur Hälfte und es sieht aus, als hätten Sie einen Karlsbader Zwilling vor
sich. Im linken Bild ist es der Kristall oben rechts. Rechts die
Vergrößerung.


Nur wenn Sie hier mit der Lupe genau hinsehen, sehen Sie in der spiegelnden
Hälfte die Plagioklaszwillinge. Das ist etwas gemein, zugegeben. So lange
Sie aber alle Feldspäte mit der Lupe kontrollieren, kann Ihnen nichts
passieren. Solche (seltenen) Fälle entdecken Sie dann rechtzeitig.
Der zweite Hinweis auf Plagioklas steckt übrigens in der Farbe des
Kristalls. Grünliche Feldspäte sind ein starkes Indiz für Plagioklas, bei
dem eine chemische Zersetzung („Alteration“) begonnen hat. Dazu gleich mehr.
Verwechselungen
Es gibt Strukturen, die den polysynthetischen Verzwillingungen ähnlich
sehen. So finden Sie ohne Mühe parallele Linien in den schillernden
Feldspatkristallen im Larvikit (nächstes Bild). Das sind keine
polysynthetischen Verzwillingungen, sondern (vermutlich) Spaltbarkeiten, zum
Teil auch Risse. Der entscheidende Unterschied ist, dass diese Strukturen
immer erkennbar sind, egal wie das Licht einfällt. Genau das gilt aber nicht
für polysynthetische Verzwillingung, denn die sind nur auf
reflektierenden Spaltflächen zu sehen.

Das folgende Bild zeigt
die Oberfläche eines Kalzitkristalls. In Kalzit kommen ebenfalls Zwillinge
vor, die denen der Plagioklase ähneln. Kalzit ist aber erheblich weicher als
Plagioklas. Hier hilft es also bereits, auf die Härte des Minerals zu
achten. (Es gibt weitere Unterschiede, die beim Kalzit besprochen werden.)

Zuletzt noch einmal besonders kräftige perthitische Entmischungen. Das
Mineral ist natürlich ein Kalifeldspat, denn seine perthitischen
Entmischungen sind immer sichtbar und nicht an Spaltflächen gebunden.
Außerdem sind diese Entmischungen niemals so gerade und dünn wie die
Zwillinge der Plagioklase. Sie zu verwechseln, wäre nur bei sehr
oberflächlicher Betrachtung möglich.

Alteration von Plagioklas
Alteration ist die
Zersetzung bzw. der Umbau von Mineralen bei hohem Druck und Temperaturen von
mehreren hundert Grad. Verantwortlich sind vor allem Wasser und CO2 im
überkritischen Zustand, die man dann als Fluide bezeichnet. Diese Fluide
greifen unter anderem Plagioklas an, der chemisch weniger stabil ist als
Alkalifeldspat. Manchmal beginnt diese Zersetzung schon bei der Abkühlung
des noch heißen, eben erstarrten Gesteins. Die Alteration der Plagioklase
beginnt mit einer schwachen Grünfärbung im Inneren der Kristalle. Mit
zunehmender Zersetzung vergrünen die Plagioklase komplett und verlieren dann
meist auch ihre polysynthetischen Verzwillingungen. Vergrünte Feldspäte sind
deshalb immer ein starkes Indiz für Plagioklas. Ursache für die Verfärbung
ist die Neubildung des Minerals Epidot.
Manche Plagioklase werden durch Alteration so stark zersetzt, dass sie kaum
noch zu erkennen sind. Im folgenden Bild ist der Kristall oben links ein
Plagioklas bzw. das, was davon noch übrig ist. Die Zersetzung fand bereits
innerhalb des Gesteins statt, der Plagioklas kam beim Zerteilen so zum
Vorschein.

Oben: Zersetzter
Plagioklas in Granit.
Unten: Vergrünte Plagioklase in einem Porphyr.

Alteration ist an hohe
Temperatur und hohen Druck gebunden und darf nicht mit Verwitterung
verwechselt werden, die bei normaler Temperatur und an der Erdoberfläche
stattfindet.
Plagioklase sind generell empfindlicher als Alkalifeldspäte. Das betrifft
Alteration ebenso wie Verwitterung. Plagioklase zersetzen sich auch auf der
Oberfläche von Gesteinen, die Wind und Wetter ausgesetzt sind, werden weiß
und können langfristig völlig verschwinden. Zurück bleiben dann nur Löcher
mit ihren Umrissen.
Um Gesteinsbeschreibungen
zu verstehen, sollten Sie die Gliederung der Plagioklasreihe kennen. Gemeint
sind die Begriffe: Albit, Oligoklas, Andesin,
Bytownit, Labradorit und Anorthit. Sie wurden in der
Vergangenheit benutzt, um den Gehalt der Plagioklase an Natrium bzw. Kalzium
zu beschreiben. Die Reihe beginnt mit dem Natriumplagioklas (Albit) und
endet mit dem kalziumbetonten Anorthit.
Heute werden diese Angaben in der Regel in Form tief gestellter
Prozentangaben zum Anorthitgehalt (An) gemacht:
-
Albit: Na[AlSi3O8] Anorthitgehalt von 0 bis 10 %. (An0-An10)
-
Oligoklas: Anorthitgehalt von 10 % bis 30 %. (An10-An30)
-
Andesin: Anorthitgehalt von 30 % bis 50 %. (An30-An50)
-
Labradorit: Anorthitgehalt von 50 % bis 70 % (An50-An70)
-
Bytownit: Anorthitgehalt von 70 % bis 90 % (An70-An90)
-
Anorthit: Ca[Al2Si2O8] Anorthitgehalt 90% bis 100 % (An90-An100)
Verwechseln Sie bitte den Plagioklas Anorthit nicht mit Anorthoklas (ein Feldspat-Mischkristall) oder Anorthosit, einem Gestein, das nur aus Plagioklas besteht.
Cleavelandit
Cleavelandit ist ein fast reiner Albit (Natriumfeldspat) mit einer blättrig-tafeligen Kristallausbildung. Ich zeige ihn hier nur der Vollständigkeit halber, denn er ist so selten, dass er bei der Gesteinsbestimmung keine Rolle spielt.
Praktische Regeln zur Unterscheidung der Feldspäte
Feldspäte sind die dominierenden Minerale in vielen Gesteinen. Fast alle hellen Minerale, sofern kein Quarz, sind Feldspäte. Zur Unterscheidung der beiden Typen helfen folgende Regeln. (Diese Regeln gelten sehr oft, aber es gibt Ausnahmen.)
-
Gibt es zwei Sorten Feldspäte und ist eine davon deutlich größer als die andere, dann sind die größeren die Alkalifeldspäte.
-
Gibt es zwei Feldspäte und ist einer davon bräunlich, rötlich oder von anderer kräftiger Farbe, dann ist das fast immer der Alkalifeldspat. Die Plagioklase in diesen Gesteinen sind meist weiß oder blass-gelblich oder transparent.
-
In seltenen Fällen kann Plagioklas rotbraun sein. Auch dann sind die Alkalifeldspäte größer und haben meist eine hell rötliche bis blass fleischfarbene Tönung. (Das gilt vor allem für Geschiebe aus Skandinavien.)
-
In Gesteinen mit nur einem Feldspat handelt es sich um Alkalifeldspat, wenn er braun, rötlich oder fleischfarben aussieht.
-
Sind die Feldspäte weiß, muss genau kontrolliert werden, ob es einen oder zwei Feldspäte gibt. Findet man zwei, kann es sich um Granit oder Granodiorit handeln, dann ist immer auch Quarz vorhanden.
-
Bei nur einem Feldspat (weiß oder transparent), wird der in einem schwarz-weißen Gestein sehr wahrscheinlich Plagioklas sein, unabhängig vom Quarzgehalt.
-
Ebenso kann man Plagioklase erwarten, wenn einheitlich weiße oder schwach grünliche Einsprenglinge in einer dunklen Grundmasse stecken.
-
Auf angewitterten Oberflächen werden die leichter verwitternden Plagioklase nach einiger Zeit weiß und fehlen später ganz. Alkalifeldspäte verwittern viel langsamer als Plagioklase.
-
Alteration färbt Plagioklase grünlich, beginnend im Inneren der Kristalle.
-
Es gibt keine lackschwarzen oder silbrig glänzenden Feldspäte.
Die folgenden Beispiele
illustrieren einige dieser Regeln.

(Vergrößerung ohne Beschriftung)
Die Bilder (oben und
unten) zeigen grobkörnige Granite. In beiden ist der Alkalifeldspat braun
oder rötlich, während die Plagioklase hell oder fast weiß aussehen. So sehen
viele magmatische Gesteine aus: Größere Alkalifeldspäte mit kräftigen
Farben, daneben kleinere Plagioklase, die blasser gefärbt sind.
(Regel 1 und
2)
Quarz ist grau oder auch blau.

Im Glazialgeschiebe findet
man vereinzelt Gesteine mit rotbraunem Plagioklas. Ich zeige Ihnen zwei der
häufigeren Vertreter. Das ist zum einen der Kökar-Rapakiwi aus dem Südosten
der Ålandinseln:

(Vergrößerung ohne Beschriftung)
Unten ein Lemland-Granit, der ebenfalls von Åland kommt und südlich der Hauptinsel ansteht. (Afs
= Alkalifeldspat, PL = Plagioklas)

(Vergrößerung ohne Beschriftung)
Unten: Beispiele für
Gesteine, die nur einen Feldspat enthalten.


Der Granit links besteht nur aus blassrötlichem Alkalifeldspat und Quarz.
Der Gabbro rechts sieht, wie alle Gabbros, schwarz-weiß aus und enthält als
einzigen Feldspat hellen Plagioklas.
Gesteine, die Plagioklas als einzigen Feldspat enthalten, sind praktisch
immer schwarz-weiß (Regel 5). Dazu noch zwei Beispiele:


Das gleichkörnige Gestein links ist ein Diorit, der im Norden der Insel
Föglö (Åland) ansteht. Als loser Stein gefunden, wäre er nicht sicher von
einem Gabbro zu unterscheiden, denn dazu müsste man den genauen
Kalziumgehalt der Plagioklase kennen. Das geht nicht von Hand, dazu braucht
man ein Labor.
Zur Unterscheidung von Gabbro und Diorit kann man sich als Hilfe merken,
dass Diorite tendenziell heller als Gabbros sind. Außerdem ist das dunkle
Mineral in Gabbros Pyroxen, während in Dioriten viel eher Biotit oder
Amphibol vorkommen. Beides sind Indizien, nicht mehr.
Das Bild rechts oben zeigt einen der vielen Diabase (= Dolerite) aus dem
nordischen Geschiebe. Das sind immer Gesteine mit Plagioklaskristallen in
einer dunklen, feinkörnigen Grundmasse. Beachten Sie die schwache
Grünfärbung des ganzen Steins. Das ist ein Zeichen für leichte Alteration.
Die Regel, dass
plagioklasbetonte Gesteine schwarz-weiß aussehen, erlaubt nicht den
Umkehrschluss, dass alles, was wie Salz und Pfeffer aussieht, automatisch
nur Plagioklas enthält. Es gibt durchaus weißen Alkalifeldspat und damit
auch sehr helle Granite. Der gleichkörnige Greifenstein-Granit aus Sachsen
oder der grob porphyrische Falkenberg-Granit aus Oberfranken sind Beispiele
dafür.

An der präzisen Bestimmung
der Feldspäte führt deshalb kein Weg vorbei. Das kann in Einzelfällen mühsam
sein und manchmal kommt man als Amateur dabei an seine Grenzen. Wenn die
Feldspäte nicht sicher bestimmbar sind, ist es besser, den Namen offen zu
lassen, als sich vorschnell festzulegen.







