| |
Dieses Gestein kommt aus dem hohen Norden Schwedens.
Der Sorsele-Granit ist nach der gleichnamigen Stadt benannt, die
westlich von Arvidsjaur liegt.
Die meisten der hier gezeigten Proben stammen von Herrn Kleis aus Steenwijk (NL).

Er hat sie südöstlich von Sorsele in der Nähe der Ortschaft Holmfors
als Nahgeschiebe gefunden. Das Anstehende dieses Granits beginnt etwas
weiter nordwestlich.
Sie finden dazu rechts zwei Karten. Die obere zeigt die Lage des
Sorsele-Granits innerhalb Skandinaviens, die untere einen Ausschnitt aus der
großen geologischen Karte.
Der Sorsele-Granit hat ein Alter von knapp 1,8 Milliarden Jahren und
gehört trotz seiner nördlichen Lage zum
Transskandinavischen
Magmatitgürtel (TMG).
Dieser Gürtel beginnt im Süden Schwedens und erstreckt sich durch
Småland, Värmland und Dalarna bis in den hohen Norden. Er wird jedoch im
Nordwesten von Dalarna vom aufliegenden
Kaledonischen Gebirge verdeckt.

Inzwischen hat die Erosion die Kaledoniden zum Teil abgetragen und das unterliegende Grundgebirge, der eigentliche Baltische
Schild, wird wieder sichtbar.
Ein solches geologisches Fenster ist es, aus dem der
Sorsele-Granit stammt. Er wird im Süden, Osten und Norden von
älteren, svekofennischen Gesteinen begrenzt. Im Westen liegen
die Kaledoniden auf dem Sorsele-Granit.
Beschreibung:
Das Gestein
ist ein undeformierter, graubrauner bis braunrötlicher, porphyrischer
Granit.
Die Feldspateinsprenglinge befinden sich in einer feinkörnigen
Grundmasse und sind meist unter einem Zentimeter klein. Sie sind von beiger bis fleischfarbener
sowie fleckig-grauer Tönung.
Die Grundmasse ist fleckig braun gefärbt,
und etwas dunkler als die Einsprenglinge.
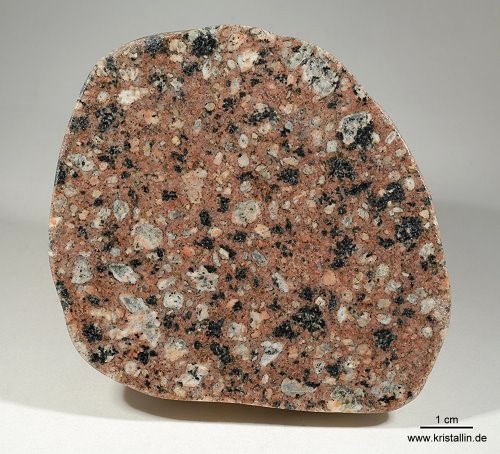

Sorsele-Granit. Nahgeschiebe, südöstlich von Sorsele. Polierter Schnitt
Die braun bis blaßbeige gefärbten Einsprenglinge sind die
Alkalifeldspäte. Die Plagioklase sind graufleckig, teilweise hellgrau
zoniert und enthalten schwach grünliche Kerne, was sehr wahrscheinlich
auf Alteration zurückzuführen ist.
Hin und
wieder finden sich Alkalifeldspäte, die von Plagioklas umwachsen sind.
Beide Feldspäte sind zum Teil idiomorph, die Plagioklase tendenziell
etwas mehr. Bei einigen Plagioklasen finden sich rhombenförmige
Umrisse. Sehr vereinzelt zeigt sich das auch bei einigen
Alkalifeldspäten.
Im nächsten Bild sind die rhombenförmigen Plagioklase zu sehen. Es
handelt sich um die grau gefleckten
Einsprenglinge links und unterhalb der Bildmitte.


Der Quarz im Sorsele-Granit ist hellgrau bis braungrau, wenig auffällig und nur in mäßiger Menge
vorhanden.
Es gibt zwei gut erkennbare Generationen von Quarz, was zwar
nicht alltäglich ist, aber immer wieder vorkommt. Das Gefüge zeigt damit
eine gewisse Nähe zu porphyrischen Rapakiwis. Der Sorsele-Granit wird
aber in der geologischen Literatur nicht als Rapakiwi geführt.
Die größeren Quarze sind unregelmäßig zerlappt bzw. korrodiert, ihre
Größe liegt bei etwa 2 - 3 mm. Der mengenmäßig meiste Quarz dürfte in den
wesentlich kleineren, kantig bis unregelmäßig geformten Quarzkörnern
stecken, die sich in Gruppen oder einzeln verteilt in der Grundmasse
zwischen dem Alkalifeldspat befinden. Lokal bilden Alkalifeldspat und
Quarz schöne graphische Verwachsungen.
Im nächsten Ausschnitt sehen Sie beide Quarzgenerationen. Die kleinen
Quarze sind jedoch so winzig, daß sie nur in der Vergrößerung zu
erkennen sind. Sie finden sie vor allem ganz rechts oben im Bild. (Einige der Quarze
sind mit einem Pfeil markiert)


Das Stück, aus dem dieser Bildausschnitt stammt, sieht im Ganzen so aus (unten):
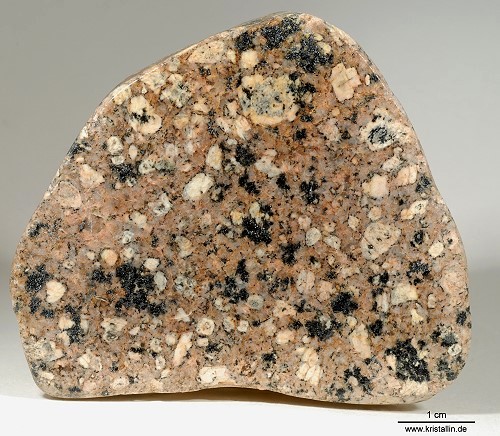

Das dunkle
Mineral ist aus meinem Probenmaterial nicht sicher zu bestimmen. Sehr
wahrscheinlich besteht ein erheblicher Teil der vielen, unscharf
begrenzten, schwarzen Butzen aus Amphibol. Biotit wird vermutlich aber
auch beteiligt sein.
In größeren Ansammlungen dunkler Minerale kommt zusätzlich Magnetit vor.
Interessant sind die schmalen dunklen Säume um die
Feldspäte. Unter der Lupe erkennt man feine schwarze Nadeln, die
parallel zur Kontur der Alkalifeldspäte und der Plagioklase auf der
Außenseite dieser Kristalle angelagert sind und deren Umrisse betonen.
In den beiden Detailbildern oben ist das deutlich zu erkennen.
Einige der Nahgeschiebe sind von deutlich dunklerer Farbe. Auch die
nächsten drei Bilder
zeigen Proben von Herrn Kleis, die aus Nordschweden stammen.
Fotos: de Jong.


Dazu noch eine braune Form.

Es ist gut möglich, daß dieser
Granit als Leitgeschiebe geeignet ist. Sein Gefüge zeigt interessante
Einzelheiten wie zum Beispiel die graugrünlichen, teilweise rhombenförmigen Plagioklase.
Herr Kleis betont aber, daß diese besonders geformten Feldspäte
nicht in allen Handstücken enthalten sind.
Trotz des sehr weit im Norden liegenden Herkunftsgebietes sind von
diesem Gestein bereits Geschiebe gefunden worden. Einige Beispiele
finden Sie hier:
Geschiebe von Sorsele-Granit. Gefunden in Damsdorf (Schleswig-Holstein)
von H. Nipperus.

Das nächste Stück stammt von der Insel Als in Dänemark. Es wurde von A. P. Schuddebeurs
und J. G. Zandstra
gefunden.

Zuletzt noch ein Exemplar, das J. A. de Jong in Nijbeets (NL) fand.

Ein herzlicher Dank geht an Herrn Kleis und Herrn de Jong für die
überlassenen Proben und Bilder.
Sobald es möglich ist, werde ich diese Abbildungen hier um Handstücke
direkt aus dem Anstehenden des Sorsele-Granits ergänzen. Wahrscheinlich
zeigen sich dann noch weitere Varianten.
Zusammenfassung:
Der
Sorsele-Granit stammt aus einem weit in Schwedens Norden gelegenen
Granitmassiv und gehört zum Transskandinavischen Magmatitgürtel.
Die gezeigten Proben haben ein porphyrisches Gefüge von braungrauer
Farbe, das je nach Gehalt an dunklen Mineralen hell oder auch dunkel
getönt sein kann.
Die Größe der Feldspäte liegt überwiegend bei höchstens einem Zentimeter,
vereinzelt kommen größere Einsprenglinge vor. Auf den Außenseiten
vieler
Feldspäte sind feinste dunkle Nadeln angelagert, die zu einer schwarzen
Einrahmung der Kristalle führen.
Einige der Plagioklase zeigen rhombenförmige Umrisse. Quarz ist nur in
mäßiger Menge vorhanden. Es gibt neben Quarzen, die um 1 bis 2 mm groß
sind, noch deutlich kleinere, die graphische Verwachsungen mit dem
Kalifeldspat bilden.
In Ansammlungen dunkler Minerale findet sich Magnetit.
|
|